Bisherige Institutsdirektorinnen und -direktoren
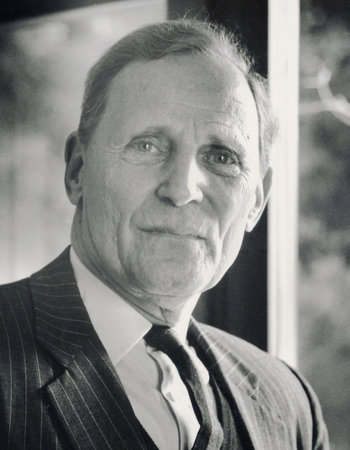
Otto Westphal (1913-2004)
(Direktor von 1961 bis 1982)Otto Westphal gründete das Max-Planck-Institut für Immunbiologie und etablierte es als eine der führenden Forschungseinrichtungen in der Immunologie. Seine wissenschaftlichen Leistungen umfassen die Bestimmung der Primärstruktur des E. coli Lipid A, einem endotoxischen Lipopolysaccharid. Er war Gründer des European Journal of Immunology und Gründungspräsident der deutschen Gesellschaft für Immunologie.
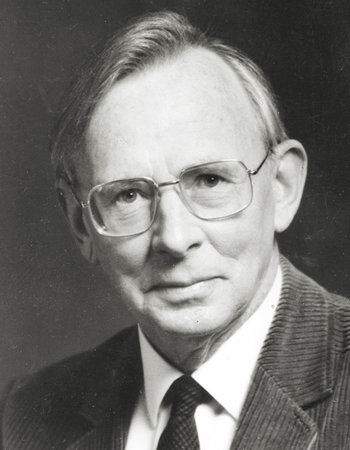
Herbert Fischer (1919-1981)
(Direktor von 1964 bis 1981)Herbert Fischer interessierte sich leidentschaftlich für Makrophagen in einer Zeit, als das Interesse der Immunologie fast vollständig auf Lymphozyten konzentriert war. Die Gruppe von Fischer erforschte die Bedeutung des Phospholipid-A-Stoffwechsels bei der Aktivierung von Makrophagen und Lymphozyten und seine daraus folgenden Auswirkungen auf die Aktivierung der angeborenen und der erworbenen Immunabwehr.

Otto Lüderitz (1920-2015)
(Direktor von 1965 bis 1988)Otto Lüderitz zeigte mit seiner Gruppe, dass Lipopolysaccharide (LPS) Gram-negativer Bakterien nach einer einheitlichen Architektur aufgebaut sind, bestehend aus einer O-Polysaccharidkette, einer Kernregion und dem Lipid A. In chemischen und biologischen Studien erbrachten sie den endgültigen Beweis, dass Lipid A das Toxin und der biologisch aktive Teil von LPS ist. Dies führte zu einer vollständigen chemischen Synthese von biologisch aktivem Lipid A.

Klaus Eichmann (*1939)
(Direktor von 1981 bis 2004)Klaus Eichmann und Kolleg:innen erforschten T-Zell-Entwicklung und –Aktivierung und den Vorgang der Antigen-Präsentation in der Zell-vermittelten Immunität. Sie entdeckten die autonome Signalfunktion des Prä-T-Zell-Rezeptors in der Entwicklung von alpha/beta-T-Zelllinien. Sie beschrieben außerdem als erste die Entwicklung funktionellen Lymphozyten aus embryonalen Stammzellen.
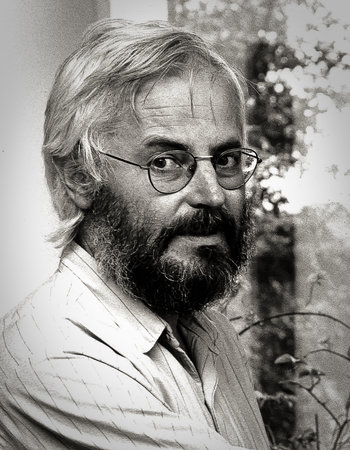
Georges Köhler (1946-1995)
(Direktor von 1984 bis 1995)In dem Jahr, in dem George Köhler ans Max-Planck-Institut kam, erhielt er – gemeinsam mit Niels Jerne und Cesar Milstein – den Nobelpreis für Physiologie und Medizin. Ausgezeichnet wurden sie für ihre bahnbrechende Arbeit über das Immunsystem und die Erzeugung monoklonaler Antikörper mittels Hybridom-Technik.

Davor Solter (*1941)
(Direktor von 1991 bis 2006)In zukunftsweisenden Experimenten untersuchte Davor Solter das Entwicklungspotenzial des mütterlichen und väterlichen Genoms durch Zellkern-Übertragung. Solter konnte als einer der ersten genomisches Imprinting nachweisen. Seine Forschung konzentrierte sich auf genetische und epigenetische Mechanismen zur Steuerung der Präimplantations-Entwicklung bei der Maus. Er trug wesentlich zu einer Reihe von Bereichen der Säuger-Entwicklung bei, unter anderem der Keimblatt-Differenzierung, der Biologie und Genetik von Teratokarzinomen, der Biologie embryonaler Stammzellen, dem Klonen und der Reprogrammierung.
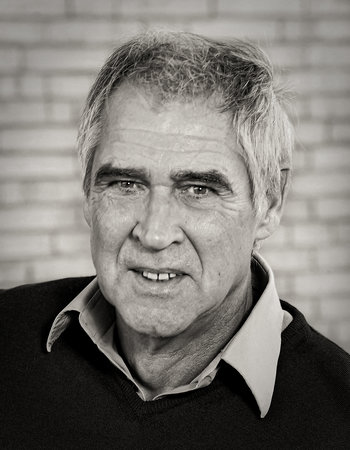
Rolf Kemler (*1945)
(Direktor von 1992 bis 2013)Als Postdoc in Francis Jacobs Labor identifizierte Rolf Kemler das erste Zell-Adhäsionsmolekül in der Entwicklung der Maus. Seine Struktur- und Funktionsanalysen führten zur Entdeckung der Catenine als zytoplasmatische Ankerproteine. Insbesondere Beta-Catenin wurde für seine zweifache Funktion in der Zell-Adhäsion und im Wnt-Signalweg bekannt. Anfang der 1980er Jahre war Kemler in Deutschland der erste, der embryonale Stammzellen der Maus züchtete. Er studierte deren Differenzierungspotenzial und nutzte ‚Gene Targeting’, um die Funktion von Cadherin und Cateninen in der Mausentwicklung, der genomischen Erhaltung und dem Potenzial als Stammzelle bzw. als onkogene Zelle zu untersuchen.
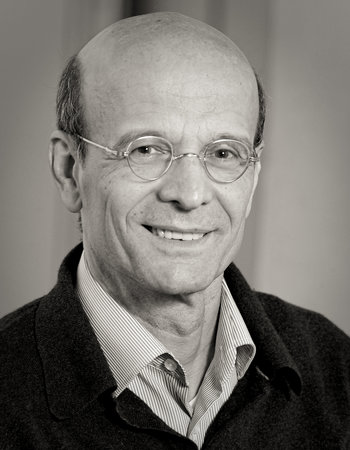
Rudolf Grosschedl (*1952)
(Direktor von 2004 bis 2020)Nach Stationen in San Francisco und München widmete sich Rudolf Grosschedl Fragen der transkriptionellen Kontrolle von zellulärer Differenzierung und ‚cell commitment’. Am MPI erforscht er die molekularen Mechanismen, die zum einen der Entstehung von B-Lymphozyten aus hämatopoietischen Stammzellen zugrunde liegen und zum anderen die Regulation der Pluripotenz embryonaler Stammzellen steuern. Mit seinen zahlreichen Beiträgen hat Rudolf Grosschedl wesentlich zum Verständnis der Entwicklung und Differenzierung des Immunsystems beigetragen.

Erika Pearce (*1972)
(Direktorin von 2015 bis 2020)Erika Pearce erforscht die regulierende Rolle des Zellstoffwechsels für das Immunsystem insbesondere bei der Entwicklung von T-Gedächtniszellen sowie für die Funktion von T-Effektorzellen. Dabei konnte sie zeigen, dass ein verändertes Nährstoffangebot die Immunantwort wesentlich beeinflusst. Ihre Forschungen zu den grundlegenden biologischen Mechanismen des Immunzellstoffwechsels haben auch große Bedeutung für die therapeutische Anwendung vor allem bei der Abwehr von Tumoren oder Pathogenen. Ab 2021 ist Erika Pearce Bloomberg Distinguished Professorin und wissenschaftliche Direktorin am Bloomberg-Kimmel Institute for Cancer Immunotherapy an der Johns-Hopkins University (USA).