Angelika Rambold
Wissenschaft als Achterbahnfahrt
Angelika Rambold ist eine Gruppenleiterin am MPI-IE. Ihr Labor erforscht die Komplexität des Immunsystems, mit einem Fokus auf der Beeinflussung von Immunreaktionen mittels Zellorganellen. Entdecken Sie ihre Begeisterung für die Wissenschaft. Erfahren Sie im Interview, warum Mut in der Wissenschaft unerlässlich ist, um den Sprung ins Unbekannte zu wagen und sich für die Höhen und Tiefen einer wissenschaftlichen Karriere zu wappnen.

Welche Fragen versucht Ihr Labor zu beantworten?
In unserem Labor erforschen wir die Schnittstelle zwischen Zellbiologie und Immunologie, um Immunzellen besser steuern zu können. Das Immunsystem ist zwar in erster Linie dafür bekannt, den Körper gegen Bedrohungen wie Krankheitserreger zu verteidigen, es kann aber auch manchmal verrückt spielen und zu Krankheiten wie Autoimmunität, Fettleibigkeit und Neurodegeneration beitragen. Unser Forschungsziel ist es, wirksame Strategien zur Steuerung dieser Immunzellen zu entwickeln, um ihre Reaktionen zu modulieren.
Aktuell konzentrieren wir uns auf Organellen. Das sind winzige Strukturen innerhalb der Immunzellen. Wir haben festgestellt, dass sie eine entscheidende Rolle dafür spielen, wie Zellen funktionieren. Mithilfe neuester Bildgebungsmethoden und Bildanalyse tauchen wir in die innere Struktur von Immunzellen ein und entschlüsseln die Details dieser Organellenwelt. Dabei haben wir bemerkt, wie Immunzellen ihre Organellen anpassen – einige schrumpfen, andere vergrößern sich, und einige bilden während der Immunantwort Organellen-Cluster aus mehreren Organellen. Diese Verhaltensweisen der Organellen zu verändern, ist ein Hauptfokus unserer Arbeit und stellt letztlich einen Weg dar, direkt die Funktionen von Immunzellen zu beeinflussen. Dabei nutzen wir einen umfassenden Ansatz, der nicht nur unser Verständnis der Funktionsweise von Immunzellen vertieft, sondern auch neue Ansätze zur Stärkung und Verbesserung von Immunreaktionen liefert.
War es schwierig, die Gutachtergremien und andere Wissenschaftler:innen von Ihrer Forschungsidee zu überzeugen, die zwei unterschiedliche Bereiche - Immunologie und Zellbiologie - miteinander verbindet?
Für einige, ja. Der Wechsel von der Zellbiologie in die Immunologie nach meiner Postdoc-Phase brachte eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Viele warnten mich davor, in dieses eher unbekannte Gebiet einzusteigen, da es bedeutete, Werkzeuge und Konzepte in einer Phase meiner Karriere neu zu erfinden, in der man normalerweise eine solide Grundlage braucht, um schnell voranzukommen.
Was hat Sie dazu bewogen, es trotzdem zu tun?
Ich hatte das Glück, während meiner Postdoc-Zeit in einem Umfeld zu sein, das mir Selbstvertrauen gab und mir erlaubte, meinen Instinkten zu folgen. In der Wissenschaft steht man oft vor der Wahl, den Ratschlägen anderer zu folgen oder das zu tun, was einen wirklich fasziniert und fesselt. Und dann gibt es in der Wissenschaft diesen einen Moment, in dem man einen mutigen Schritt wagen muss. Ich hatte das Glück, dass ich meine Zehen vorher einmal eintauchen konnte, bevor ich mich voll und ganz darauf eingelassen habe.
Am Ende war für einen erfolgreichen Wechsel zwischen den Forschungsbereichen entscheidend, das richtige Forschungsumfeld für den Aufbau meiner Forschungsgruppe zu finden. Zum Glück fand ich bei Max Planck ein ideales Zuhause, das mir nicht nur eine hervorragende wissenschaftliche Infrastruktur bot, sondern auch das Privileg meine Gruppe über einen Zeitraum von neun Jahren zu leiten. Im Gegensatz zu anderen Programmen, die auf 5 Jahre befristet sind, gab mir dieser längere Zeitraum die nötige Zeit, diese Übergangsphase zu durchlaufen und am Ende auch Projekte erfolgreich zu vollenden.
War es Ihnen immer klar, dass Sie Wissenschaftlerin werden würden?
Nicht wirklich. Ich denke, es gab schon früh gewisse Faktoren dafür. Ich hatte schon immer Spaß am Lösen von Problemen und interessierte mich für Detektivgeschichten. Aber ich glaube, der entscheidende Moment, der mich zur biomedizinischen Wissenschaft führte, war mit etwa zwölf. Meine Mutter hatte Atemprobleme. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert und wegen ihrer Symptome behandelt, aber niemand konnte ihren Zustand diagnostizieren. Ihr ging es einige Wochen später wieder gut ging. Aber mir machte diese Ungewissheit klar, wie wichtig es ist, die Ursachen von Krankheiten zu ermitteln. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass sich diese Idee – eventuell in die Wissenschaft zu gehen – in meinem Kopf bildete.
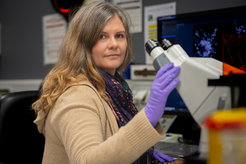
Gibt es einen Rat, den Sie Ihrem jüngeren Ich am Anfang der Karriere geben würden?
Es gibt nichts, was ich wirklich bereue. Doch es gibt ja immer wieder Phasen, in denen man Höhen und Tiefen durchlebt. Vor allem als Doktorand:in oder Postdoc erlebt man Projekte viel intensiver als später als PI. Die Momente, in denen Experimente scheitern und alles zum Stillstand zu kommen scheint, sind hart. Als Gruppenleiterin geht die Achterbahnfahrt Wissenschaft dann auf einer anderen Ebene weiter – man jongliert mit Förderanträgen und Bürokratie, leitet ein Labor und bringt sein Familienleben unter einen Hut. Die Bewältigung dieser Herausforderungen geben aber die Widerstandskraft und den Mut für zukünftige Projekte. Unabhängig von der Karrierestufe würde ich sagen: Folge deinem Bauchgefühl, vertrau’ dir selbst und dann: den Sprung ins kalte Wasser einfach wagen.
Was gefällt Ihnen von den vielen Aufgaben, die Sie als Gruppenleiterin haben am besten?
Selbst als Gruppenleiterin gehe immer noch am liebsten zum Mikroskop. Für mich ist das wirklich das Wesentliche daran, eine Wissenschaftlerin zu sein – jeder Tag birgt die Möglichkeit, etwas zu sehen, was noch niemand zuvor gesehen hat. Dieser Prozess getrieben von Neugier, die Zusammenarbeit mit meinem Team und meinen Kolleg:innen während des Brainstormings und das Nachdenken über verschiedene Hypothesen, warum die Dinge so sind wie sie sind, ist für mich zweifellos der schönste Teil der Wissenschaft. Aber es ist auch ein sehr tolles Gefühl, am Ende die fertige Geschichte als Publikation in Händen zu halten.










